Zusammenfassung:
Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx 1. Der traditionelle Marxismus der Arbeiterbewegung •Der klassische „Marxismus“ der
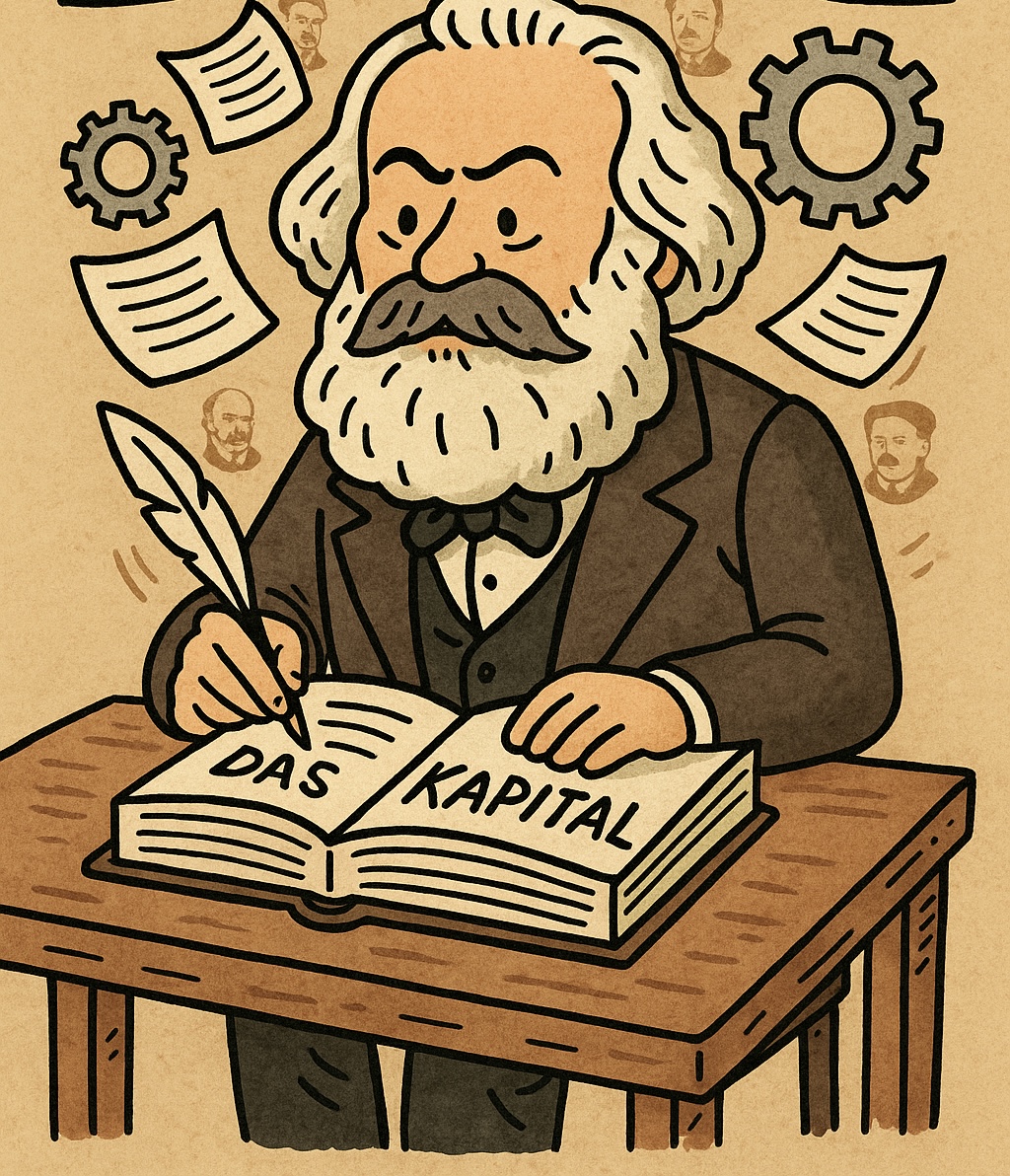 Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx
Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx
Der traditionelle Marxismus der Arbeiterbewegung •Der klassische „Marxismus“ der Arbeiterbewegung basiert meist auf Engels’ Vereinfachung von Marx’ Theorie – als Fortschrittslehre und Weltanschauung. •Die ökonomische Kritik von Marx wird auf Arbeitswertlehre, Ausbeutung und Krisen reduziert – nicht als Bruch mit, sondern als Fortsetzung der klassischen politischen Ökonomie verstanden. •Moralische Argumentationen (Gerechtigkeit) treten an die Stelle der Kritik gesellschaftlicher Formen. •Ab den 1960ern beginnt eine neue Lesart von Das Kapital, die Marx nicht als Fortsetzer der Ökonomie, sondern als deren Kritiker begreift. •Zentrale Kategorie ist der Fetischismus: gesellschaftliche Verhältnisse erscheinen als Sachverhältnisse. •Marx’ Kritik richtet sich gegen die Form der Ökonomie selbst – gegen die Versachlichung und die blinde Dynamik der Verwertung.
Wert und Geld •Der traditionelle Marxismus interpretiert die Werttheorie als Arbeitsmengentheorie – Geld wird dabei als nebensächliches Zirkulationsmittel behandelt. •Marx hingegen entwickelt den Wertbegriff aus der Geldform: Abstrakte Arbeit kann nur durch Geld als Wert erscheinen. •Geld ist nicht neutral, sondern die notwendige Vermittlungsform gesellschaftlicher Arbeit. •Nur durch ein allgemeines Äquivalent (Geld) können Waren als Werte aufeinander bezogen werden. •Geld ist die konkrete Erscheinung der Abstraktion „Wert“ – mehr als bloßer Tauschvermittler. •Die Möglichkeit von Krisen ergibt sich direkt aus dieser Struktur: Trennung von Kauf und Verkauf, Verselbständigung des Geldes. •Kredit ist nicht äußerlich, sondern strukturell notwendig für Reproduktion und Akkumulation. •Das Kreditsystem erzeugt fiktives Kapital – spekulative Verwertungsformen ohne realen Produktionsbezug.
Gleichgewicht und Krise •Neoklassik und Keynesianismus operieren mit Gleichgewichtsmodellen – Marx dagegen denkt vom Widerspruch her. •Kapital ist Bewegung – Maßlosigkeit, Verwertung ohne Ende, krisenhafte Dynamik. •Das „Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate“ ist theoretisch schwach begründet – Marx’ Krisentheorie ist davon aber nicht abhängig. •Zentrale Krisentendenz: Widerspruch zwischen Produktion und Realisation. Konsumtionskraft ist begrenzt – durch Löhne wie durch Akkumulationslogik. •Die Entscheidung zwischen industrieller Akkumulation und spekulativem Kapitalfluss führt zu Konjunkturen und Krisen. •Die Unsicherheit der Zukunft ist strukturell bedingt – durch die Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise selbst. •Krisen sind keine bloßen Marktstörungen, sondern gewaltsame „Lösungen“ von systemischen Widersprüchen – mit sozialen Verwüstungen. •Marx liefert keine Zusammenbruchstheorie, sondern eine Theorie permanenter Krisenzyklen. •Die Krise produziert neue Verhältnisse, aber keine endgültige Stabilität – es entstehen neue Widersprüche. •Die Marxsche Kritik ist aktueller denn je: Globalisierung, Finanzmärkte, relative Mehrwertproduktion – alles hat sich eher vertieft als erledigt.
